auf uns gekommen sind, sich zwei Stücke finden, in welchen der k?rperliche Schmerz nicht der kleinste Teil des Unglücks ist, das den leidenden Helden trifft. Au?er dem Philoktet, der sterbende Herkules. Und auch diesen l??t Sophokles klagen, winseln, weinen und schreien. Dank sei unsern artigen Nachbarn, diesen Meistern des Anst?ndigen, da? nunmehr ein winselnder Philoktet, ein schreiender Herkules, die l?cherlichsten unertr?glichsten Personen auf der Bühne sein würden. Zwar hat sich einer ihrer neuesten Dichter 8) an den Philoktet gewagt. Aber durfte er es wagen, ihnen den wahren Philoktet zu zeigen?
{8. Chateaubrun.}
Selbst ein Laokoon findet sich unter den verlornen Stücken des Sophokles. Wenn uns das Schicksal doch auch diesen Laokoon geg?nnet h?tte! Aus den leichten Erw?hnungen, die seiner einige alte Grammatiker tun, l??t sich nicht schlie?en, wie der Dichter diesen Stoff behandelt habe. So viel bin ich versichert, da? er den Laokoon nicht stoischer als den Philoktet und Herkules, wird geschildert haben. Alles Stoische ist untheatralisch; und unser Mitleiden ist allezeit dem Leiden gleichm??ig, welches der interessierende Gegenstand ?u?ert. Sieht man ihn sein Elend mit gro?er Seele ertragen, so wird diese gro?e Seele zwar unsere Bewunderung erwecken, aber die Bewunderung ist ein kalter Affekt, dessen unt?tiges Staunen jede andere w?rmere Leidenschaft, sowie jede andere deutliche Vorstellung ausschlie?et.
Und nunmehr komme ich zu meiner Folgerung. Wenn es wahr ist, da? das Schreien bei Empfindung k?rperlichen Schmerzes, besonders nach der alten griechischen Denkungsart, gar wohl mit einer gro?en Seele bestehen kann: so kann der Ausdruck einer solchen Seele die Ursache nicht sein, warum demohngeachtet der Künstler in seinem Marmor dieses Schreien nicht nachahmen wollen; sondern es mu? einen andern Grund haben, warum er hier von seinem Nebenbuhler, dem Dichter, abgehet, der dieses Geschrei mit bestem Vorsatze ausdrücket.
II.
Es sei Fabel oder Geschichte, da? die Liebe den ersten Versuch in den bildenden Künsten gemacht habe: so viel ist gewi?, da? sie den gro?en alten Meistern die Hand zu führen nicht müde geworden. Denn wird itzt die Malerei überhaupt als die Kunst, welche K?rper auf Fl?chen nachahmet, in ihrem ganzen Umfange betrieben: so hatte der weise Grieche ihr weit engere Grenzen gesetzet, und sie blo? auf die Nachahmung sch?ner K?rper eingeschr?nket. Sein Künstler schilderte nichts als das Sch?ne; selbst das gemeine Sch?ne, das Sch?ne niedrer Gattungen, war nur sein zuf?lliger Vorwurf, seine übung, seine Erholung. Die Vollkommenheit des Gegenstandes selbst mu?te in seinem Werke entzücken; er war zu gro?, von seinen Betrachtern zu verlangen, da? sie sich mit dem blo?en kalten Vergnügen, welches aus der getroffenen ?hnlichkeit, aus der Erw?gung seiner Geschicklichkeit entspringet, begnügen sollten; an seiner Kunst war ihm nichts lieber, dünkte ihm nichts edler, als der Endzweck der Kunst.
"Wer wird dich malen wollen, da dich niemand sehen will", sagt ein alter Epigrammatist 1) über einen h?chst ungestaltenen Menschen. Mancher neuere Künstler würde sagen: "Sei so ungestalten, wie m?glich; ich will dich doch malen. Mag dich schon niemand gern sehen: so soll man doch mein Gem?lde gern sehen; nicht insofern es dich vorstellt, sondern insofern es ein Beweis meiner Kunst ist, die ein solches Scheusal so ?hnlich nachzubilden wei?." {1. Antiochus. (Antholog. lib. II. cap. 43). Harduin über den Plinius (lib. 35. sect. 36 p. m. 698) legt dieses Epigramm einem Piso bei. Es findet sich aber unter allen griechischen Epigrammatisten keiner dieses Namens.}
Freilich ist der Hang zu dieser üppigen Prahlerei mit leidigen Geschicklichkeiten, die durch den Wert ihrer Gegenst?nde nicht geadelt werden, zu natürlich, als da? nicht auch die Griechen ihren Pauson, ihren Pir?ikus sollten gehabt haben. Sie hatten sie; aber sie lie?en ihnen strenge Gerechtigkeit widerfahren. Pauson, der sich noch unter dem Sch?nen der gemeinen Natur hielt, dessen niedriger Geschmack das Fehlerhafte und H??liche an der menschlichen Bildung am liebsten ausdrückte 2), lebte in der ver?chtlichsten Armut 3). Und Pir?ikus, der Barbierstuben, schmutzige Werkst?tte, Esel und Küchenkr?uter, mit allem dem Flei?e eines niederl?ndischen Künstlers malte, als ob dergleichen Dinge in der Natur so viel Reiz h?tten, und so selten zu erblicken w?ren, bekam den Zunamen des Rhyparographen 4), des Kotmalers; obgleich der wollüstige Reiche seine Werke mit Gold aufwog, um ihrer Nichtigkeit auch durch diesen eingebildeten Wert zu Hilfe zu kommen.
{2. Jungen Leuten, befiehlt daher Aristoteles, mu? man seine Gem?lde nicht zeigen, um ihre Einbildungskraft, so viel m?glich, von allen Bildern des H??lichen rein zu halten. (Polit. lib. VIII. cap. 5. p. 526. Edit. Conring.) Herr Boden will zwar in dieser Stelle anstatt Pauson, Pausanias gelesen wissen, weil von diesem bekannt sei, da? er unzüchtige Figuren gemalt habe (de umbra poetica, comment. I. p. XIII.). Als ob man es erst von einem philosophischen Gesetzgeber lernen mü?te, die Jugend von dergleichen Reizungen der Wollust zu entfernen. Er h?tte die bekannte Stelle in der Dichtkunst (cap. II. ) nur in Vergleichung ziehen dürfen, um seine Vermutung zurückzubehalten. Es gibt Ausleger (z. E. Kühn, über den ?lian Var. Hist. lib. IV. cap. 3), welche den Unterschied, den
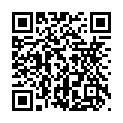
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



