Ein Brauhaus, Backhaus, Schlachthaus, Schmiede,
Mühle, Küche und Keller waren noch da, worin die verschiedenen
Klosterhandwerker hausten und hantierten; auf dem Thorhaus saß
der Thorwärter Thalheym. Ein „Hellenheyszer“ hatte die Oefen
zu besorgen.
Es war eine gar umfangreiche Wirtschaft und ein großes Personal:
40-50 Leute waren in der Klosterzeit Katharinas von Bora täglich
„über den Hof“ zu speisen; und dazu mußten Löhne gezahlt
werden, vom Oberknecht mit 4 Schock 16 Groschen und Vorsteher mit
4 Schock an bis zur Gänsehirtin, welche nur 40 Groschen bekam.
Um alle diese Personen zu besolden und neben den Klosterfrauen zu
speisen, brauchte es natürlich großer Einkünfte an Geld,
Getreide, Hühnern, Eiern u.s.w. von den Klosterdörfern und
Höfen, außer den Klostergütern, die vom Klosterpersonal selbst
bewirtschaftet wurden. Ferner hatten die Bauern noch gar manche
Fronden mit Ackern, Düngen, Dreschen, Mähen und Heuen,
Schneiden, Holzmachen, Hopfen pflücken, Flachs und Hanf raufen,
riffeln und rösten, Schafscheren, Jagdfron (Treiben bei der Jagd)
wofür teilweise Essen und Trinken, bei der Jagd auch Geld gereicht
wurde.
Die Nonnen selbst wohnten in der „Klausur“, einem zweiten
Gebäudekomplex, welcher im Viereck um einen kleinen Hof gebaut
war und aus der Kirche, dem Refektorium (Speisehaus), dem
Dormitorium (Schlafhaus mit den Zellen) und dem Konvent
(Versammlungshaus) bestand. Die Abtei, die Wohnung der Aebtissin,
welche nicht zur Klausur gehörte, war zwischen dieser und dem
Propsthofe.
Hier im Kloster lebten nun einige vierzig Töchter adeliger Häuser
aus verschiedenen Gegenden des kurfürstlichen und herzoglichen
Sachsen. Dazu kamen noch ein halb Dutzend „Konversen“ oder
Laienschwestern, die um Gottes willen, d.h. umsonst dienten. Ferner
mehrere bezahlte „Kochmeide“, darunter eine Köchin, und die
„Frauen-Meid“, d.h. die Dienerin der Aebtissin. Diese hatte
außerdem noch zwei Knaben zu ihrer Verfügung, die natürlich
im äußern Klosterhof wohnten und zu Kleidern und Schuhen
zusammen 1 Schock jährlich erhielten[32].
Die adeligen Klosterfrauen bildeten die Sammlung, den Konvent und
hießen daher auch Konventualinnen. Das war eine kleine weibliche
Adelsrepublik, die sich in allen Dingen selbst regierte nach der
„Regel“, den Gesetzen, auf die sie eingeschworen waren —
bloß unter Oberaufsicht ihres Visitators, des Abtes von Pforta, der
aber auch nur auf Grund der Regel anordnen und rügen konnte. Die
Regel war die des hl. Bernhard, eine etwas strengere Abart derjenigen
der gewöhnlichen alten Benediktinerinnen[33].
Die Nonnen waren außer der Aebtissin in die Klausur eingeschlossen,
aus welcher sie nur in Klosterangelegenheiten mit besonderer Erlaubnis,
und dies selten und in Begleitung einer Seniorin und des Beichtvaters,
heraustreten durften. Ein Verkehr mit der Außenwelt oder auch nur
mit den Klosterleuten auf der Propstei fand nicht statt; auch in der
Kirche waren sie auf einem besonderen dicht vergitterten Nonnenchor
den Blicken der Weltleute entzogen. Verboten war ausdrücklich das
Uebersteigen an der Orgel und das Herauslehnen über die
Umzäunung des Chors. Wenn jemand von draußen (Geistlicher
oder Weltlicher) mit einer Klosterjungfrau zu reden hatte, etwa die
Eltern und Geschwister zu Besuch kamen, so durften sie nur mit
besonderer Erlaubnis der Aebtissin, und nur wenn es die Not erforderte,
in der Redstube durch das vergitterte Redfenster und in Gegenwart der
Aebtissin mit ihr sprechen; es war unmöglich gemacht, daß jemand
die Hand oder ein Ding durch das Fenster steckte. Ebenso war der
Beichtstuhl vermacht, und selbst der Beichtvater durfte nur in
Krankheitsfällen in die Klausur eintreten. Festlichkeiten und
Ergötzungen sollten die Beichtväter nicht mit den
Klosterjungfrauen mitmachen. Der Pförtnerin war bei Strafe verboten,
Hunde (?), alte Weiber und dgl. einzulassen[34]. Die Schwestern
durften auch nicht mit den Klosterkindern[35] zusammen schlafen.
In diesem klösterlichen Verband gab es zur Regierung und
Verwaltung der Gemeinschaft zahlreiche Aemter. Mit ziemlich
unumschränkter Gewalt herrschte die gewählte _Aebtissin_: ihrem
Befehl und ihren Strafen war mit wortlosem, unbedingtem Gehorsam
nachzukommen; doch war sie gehalten, überall den Rat ihrer
„Geschworenen und Seniorinnen“ zu hören. Ihr war nicht nur
die äußere Verwaltung der Gemeinschaft übertragen, auch die
„Leitung der Seelen und Gewissen“. Sie sollte sich bestreben,
gleich liebreich gegen alle, Junge und Alte, aufzutreten, für alle,
Gesunde und Kranke, namentlich in ihrer leiblichen Notdurft, besorgt
zu sein.
Mit Ehrfurcht nahten die Schwestern der Aebtissin, sie war die Domina
(Herrin), die ehrwürdige Mutter, und die draußen wenigstens
nannten sie „Meine gnädige Frau.“ Im Jahr 1509, also kurz
nachdem Katharina von Bora in Nimbschen eingetreten war, starb die
alte Aebtissin Katharina von Schönberg, und Katharinas Verwandte,
Margarete von Haubitz, wurde zur Aebtissin gewählt und feierlich
vom Abt Balthasar aus Pforta in ihr Amt eingeführt[36].
Nach der Aebtissin kam an Würde die Priorin („Preilin“),
einerseits die Stellvertreterin und Gehülfin derselben, andererseits
aber auch die Vertreterin und Vertrauensperson des Konvents. Auf sie
folgte die „Kellnerin“, die „Bursarin“ (auch
„Bursariusin“, Kassiererin) die Küsterin, die Sangmeisterin
(„Sängerin“), die Siech- und Gastmeisterin[37].
Die Schwesternschaft, in welche die junge Katharina eintrat, hatte
einen gleichartigen gesellschaftlichen Rang: sie waren alle aus dem
kleinen Adel und vielfach mit einander verwandt oder gar Schwestern:
so die zwei Haubitz, die zwei Schwestern Zeschau und Margarete und
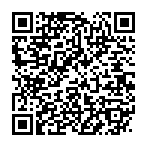
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



