erwartete Goldregen aus. Die
Enttäuschung wäre wohl noch bitterer gewesen, wenn sie auf einmal
gekommen wäre, aber man konnte ja noch immer hoffen auf günstigen
Umschlag, auf Rückkehr der alten Zeiten, und über diesen Hoffnungen
vergingen sachte die Jahre und die vierzehn Bögen gerieten allmählich
in Vergessenheit.
Es kamen andere Sorgen, die der Familie näher gingen. Da war zuerst
der schon früher erwähnte Tod der Tochter Aurora, dann starb das nach
Pauline geborene Töchterchen, Sophie, etwa sechsjährig, an Croup. Bis
in ihr Alter erinnerte sich Pauline dieser lieblichen kleinen Schwester
und des Augenblicks, da diese in ihrer Todesnot nach Atem ringend ihr
Bettkittelchen von unten bis oben zerriß, um Luft zu bekommen. Noch
trauernd um diesen Verlust sah die Mutter einen noch herberen nahen,
fühlte sie die Grundfeste des Hauses wanken. Ihr bis dahin so gesunder
Mann erlitt im Jahre 1834 einen Schlaganfall, dem später noch weitere
folgten. Für ihn und die Seinen entstand daraus eine schwere
Leidenszeit. In verschiedenen Briefen an ihre treue Schwester Adelheid,
die mit Rektor Roth in Nürnberg verheiratet war und an die
Verwandten in Württemberg spricht sich der tiefe Kummer über die
Krankheit, die bange Sorge vor der Zukunft aus. Sie schreibt: »Ihr
glaubt nicht, in welcher Spannung und Angst ich lebe, ich bin nur froh,
wenn ein Tag wieder herum ist. Oft denke ich: nur auch einmal möchte
ich mich wieder niederlegen, ohne daß die schweren Sorgen mich
drücken, die werden mich aber wohl nicht mehr verlassen, besser
kommt es wohl nimmer, aber schlimmer kann es ja noch werden.« Es
gibt wohl kaum eine größere Qual als die, welche sie nun durchmachen
mußte; zusehen, wie nicht nur die körperlichen, sondern auch die
geistigen Kräfte des geliebten Mannes infolge jedes neuen Anfalls
immer mehr abnahmen. Dazu kam, daß er selbst sich zeitweise dieses
Zustands bewußt und dann im höchsten Grade erregt war.
Den Kindern blieb ein Auftritt in Erinnerung, unter dem sie ihre Mutter
erzittern sahen. Sie saß am Bette des Mannes, der sie immer um sich
haben wollte, und mit dem zu sprechen doch so qualvoll war, weil ihm
oft die Worte nicht zu Gebote standen und er dadurch in wachsende
Erregung geriet. So suchte er diesmal nach einem Namen, konnte ihn
nicht finden und fragte seine Frau: »Wie heißt der Student, der so oft zu
uns kommt?« Sie nannte einen Namen und wieder einen, jeder falsche
Vorschlag regte ihn mehr auf und sie besann sich in wachsender Angst
auf die zahllosen Studenten, die jemals aus- und eingegangen waren,
bis er endlich in Wut ausbrechend ihr zurief: »Du Rabenmutter, es ist ja
Dein eigener Sohn!« Der Sohn Heinrich war es, dessen Namen er
gesucht hatte. Auf solche Stunden der Erregung folgten auch wieder
ruhigere, in denen sein früheres liebevolles, anspruchloses Wesen zum
Ausdruck kam, denn auch bei geistig Erkrankten tritt ihr eigentliches
Naturell zeitweise zutage. Der selbstlose Mensch wird immer zu
unterscheiden sein von dem Egoisten, der feinfühlende von dem
gemeinen, und es hat etwas unendlich Rührendes, wenn solch edle
Eigenschaften durchleuchten zwischen den durch die Krankheit
verdunkelten Stunden.
So blieb auch diesem Kranken die Liebe und Verehrung der Seinen treu
bis zu dem Augenblick, wo ihn der Tod erlöste, im Sommer 1835.
Wie es der Witwe zumute war, als sie allein stand mit ihrer Kinderschar,
spricht sie aus gegen den ältesten Sohn Heinrich, der damals schon eine
Anstellung hatte an dem theologischen Seminar im Kloster Schönthal
in Württemberg.
Lieber Heinrich!
Schwere kummervolle Tage habe ich zurückgelegt seit Du von uns
gingst und noch immer kann ich mich an den Gedanken nicht
gewöhnen, daß Ihr für dieses Leben keinen Vater mehr habt und daß
auch mir die Seele von meinem Leben fehlt. Die erste Zeit wurde mir
dadurch leichter, weil der Gedanke, daß er nun Ruhe habe, mir so
tröstlich war. Allein jetzt, seit die Erinnerung an seine Leiden
schwächer wird und sein Bild wieder in meiner Seele lebendig wird,
wie er früher war, mit welcher Liebe er an uns hing und mit welcher
Treue er alle seine Pflichten erfüllte und wie sein Geist und Beispiel
noch so wohltätig für seine Kinder gewesen wäre, da möchte ich wohl
fragen: warum Du lieber Gott hast Du uns das wohl getan? und schwer
wird es mir, mich mit Ergebung in Gottes Willen zu fügen. Ich habe
mit der schmerzlichsten Sehnsucht gehofft, er werde vor seinem Ende
noch so viel Bewußtsein bekommen, daß er seinen Kindern auch noch
einen Segen, mir nur auch ein Trosteswort zurücklassen könne, denn
schon bei einer kurzen Trennung tut es wohl, wenn man Abschied
nehmen kann und ich mußte bei dieser schmerzlichen und vielleicht
langen Trennung auch diesen Trost noch entbehren ....
II.
1835-1849
Unsere kleine Pauline war inzwischen ein Schulmädchen geworden, ein
begabtes, wenn auch nicht eben ein fleißiges. Sie konnte, wenn es
darauf ankam, schon ganz ordentliche Briefe schreiben. Es ist
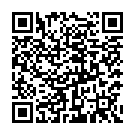
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



