dürfen, hätte mir auch nichts
geholfen.“ Die Einsegnung ging vor sich und zwar war Katharina
von „Bhor“ als einzige auf diesen Tag geweiht. Sie spendete dabei
dem Kloster von dem wenigen, was sie vermochte, 30 Groschen[50].
Zwar nicht widerwillig, aber doch wie sie (bezw. Luther) später sagte,
ohne „ihren Willen“ wurde Katharina als Tochter des sel. Vaters
Bernhard verpflichtet. Trotzdem aber hat sie sich in die Klosterregel
nicht nur gefügt, sondern auch „hitzig und emsig und oft
gebetet“[51].
Das entspricht ihrer gesamten entschiedenen Natur, wie sie sich
später ausgereift zeigt. Sie war ja gelehrt worden, durch „gute
Werke“, insbesondere durch Klosterwerke, erwerbe man sich
himmlische Güter und geldliches Vermögen und einen hohen
seligen Sitz im Jenseits; also strengte sie alle Kraft und allen Fleiß an,
solchen Reichtum zu erwerben und durch geistliche Uebungen sich
einen guten Platz im Himmel zu verdienen. Was sie später als Frau
einmal angriff, das erstrebte sie auch mit der ganzen Gewalt und
Zähigkeit ihres Willens, und so wird sie es auch im Kloster gehalten
haben als Nonne. Zudem pflegen junge Klosterleute, namentlich
weibliche, die eifrigsten zu sein in der Uebung der Pflichten, auch
wenn sie nichts von Schwärmerei an sich haben.
Und was hatte nun die junge Nonne für hohe Werke und heilige
Pflichten zu thun?
Fast das gesamte Leben im Kloster füllten geistliche Uebungen aus,
ihr ganzes Tagewerk war Beten, Singen, Lesen, Hören erbaulicher
Dinge, „da“, wie es in einer Klosterregel heißt, „alle Klausur
und geistliche Leute erdacht und gemacht sind, daß sie unserm Herrn
und Gott dienen und für Tote und Lebende und alle Gebresthafte
Bitten füllen“. Das waren nun außer dem Messesingen und den
privaten Gebeten noch besonders die gemeinsamen 7 Gebetszeiten, die
Horen: Matutin, Terz, Sext, Non am Morgen, Vesper und Komplet am
Abend mit Psalmen, Martyrologien, Ordensregeln. Auch nächtliche
Gottesdienste wurden begangen: Metten und Vigilien. Und sogar
während des Essens, wo Stillschweigen geboten war, wurde
vorgelesen aus einem Erbauungsbuch. Abwechselnd hatte Katharina
auch selbst diese Vorlesung zu halten und mußte dann
nachspeisen[52].
Welchen Eindruck diese Vorschriften auf ein natürlich fühlendes
und religiöses Gemüt machen mußten, hören wir aus einem
späteren Bericht: „Da D. Martinus der Nonnen Statuten las, die gar
kalt geschrieben und gemacht waren, seufzte er sehr und sprach:
„Das hat man müssen hochhalten und hat dieweil Gottes Wort
vermisset! Sehet nur, was für eine Stockmeisterei und Marter der
Gewissen im Papsttum gewest ist, da man auf die horas canonicas und
Menschensatzungen drang, wie Hugo geschrieben, daß wer nur eine
Silbe ausließe und nicht gar ausbetete, müßte Rechenschaft
dafür geben am jüngsten Gericht[53].“
Ob Katharina je ein Amt in dem Konvent bekleidet hat, wissen wir
nicht; jedenfalls konnte dies nur ein niederes, etwa das einer
„Siechenmeisterin“ sein. Wahrscheinlich aber war sie noch zu
jung, als daß bei so vielen Vorgängerinnen an sie die Reihe
gekommen wäre[54].
Eigentliche Arbeit gab es im Kloster nicht: die Nonnen durften ja nicht
aus der Klausur, und die Hausarbeit in Küche und Stube schafften
die Laienschwestern und Klostermägde. Freilich so ganz arbeitslos
wie bei manchen adeligen Mönchsorden, wovon der Volkswitz sagt:
Kleider aus und Kleider an Ist alles, was die Deutschherrn than.
— so träge verfloß das Leben der Nonnen nicht. Konnten sie sich
doch mit weiblichen Handarbeiten abgeben wie Spinnen von dem
Ertrag der großen Schafherden für die wollene Bekleidung,
namentlich aber mit Stickereien, wie Altardecken, Meßgewänder,
Teppiche, Fahnen u.s.w., in Nimbschen, wohl auch in Pforta für die
Kirche der dortigen Mönche und vielleicht auch für den Bischof
von Meißen, unter dem das Kloster stand[55]. So hat jedenfalls auch
Schwester Katharina manche kunstvolle Stickerei verfertigt, wenn auch
die mancherlei Handarbeiten, welche heutzutage da und dort von
Luthers Käthe gezeigt werden, wohl alle nicht echt sind.
Eine gewisse Unterhaltung gewährte noch die Besichtigung und
Instandhaltung der zahllosen Reliquienstücke, welche in der
Nimbscher Kirche aufgespeichert waren, und welche es galt zu
schmücken und in Ordnung zu halten. Es waren da an den 12
Altären in Kreuzen, Monstranzen, Kapseln, Tafeln wohl vierhundert
hl. Partikeln. So von Christi Tisch, Kreuz und Krippe, Kleid und Blut
und Schweißtuch, vom Stein und Boden, wo Jesus über Jerusalem
weinte, im Todesschweiß betete, gegeißelt saß, gekreuzigt ward,
gen Himmel fuhr; vom Haar, Hemd, Rock, Grab der hl. Jungfrau; von
den Aposteln allerlei Knochen, auch Blut Pauli, vom Haupt und Kleid
Johannes' des Täufers; von vielen Heiligen, bekannten und
unbekannten: den 11000 Jungfrauen, der hl. Elisabeth von Thüringen,
der hl. Genoveva, dem hl. Nonnosus, der hl. Libine Zähne, Hände,
Arme, Knochen, Schleier, Teppiche —, ferner Partikeln von der
Säule Christophs, vom Kreuz des Schächers u.a.[56].
Aber auch hier hatten die Seniorinnen, u.a. auch Magdalena von Bora,
die Obhut über die hl. Kapseln.
Vor allen diesen Reliquien wurden bestimmte Antiphonien gesungen,
was eine gewisse Abwechslung in dem täglichen Gottesdienst gab.
Eine Abwechslung in dem ewigen Einerlei brachten auch die vielen
Festtage, Bittgänge und Prozessionen im
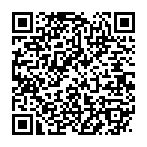
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



