man nunmehr nach den fernsten Zielen schiessen. Freilich, der europ?ische Mensch empfindet diese Spannung als Nothstand; und es ist schon zwei Mal im grossen Stile versucht worden, den Bogen abzuspannen, einmal durch den Jesuitismus, zum zweiten Mal durch die demokratische Aufkl?rung: - als welche mit Hülfe der Pressfreiheit und des Zeitunglesens es in der That erreichen dürfte, dass der Geist sich selbst nicht mehr so leicht als "Noth" empfindet! (Die Deutschen haben das Pulver erfunden - alle Achtung! aber sie haben es wieder quitt gemacht - sie erfanden die Presse.) Aber wir, die wir weder Jesuiten, noch Demokraten, noch selbst Deutsche genug sind, wir guten Europ?er und freien, sehr freien Geister - wir haben sie noch, die ganze Noth des Geistes und die ganze Spannung seines Bogens! Und vielleicht auch den Pfeil, die Aufgabe, wer weiss? das Ziel.....
Sils-Maria,
Oberengadin im Juni 1885.
Erstes Hauptstück:
Von den Vorurtheilen der Philosophen.
1.
Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben: was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt! Welche wunderlichen schlimmen fragwürdigen Fragen! Das ist bereits eine lange Geschichte, - und doch scheint es, dass sie kaum eben angefangen hat? Was Wunder, wenn wir endlich einmal misstrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehn? Dass wir von dieser Sphinx auch unserseits das Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich "zur Wahrheit"? - In der that, wir machten langen Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens, - bis wir, zuletzt, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehen blieben. Wir fragten nach dem Werthe dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewissheit? Selbst Unwissenheit? - Das Problem vom Werthe der Wahrheit trat vor uns hin, - oder waren wir's, die vor das Problem hin traten? Wer von uns ist hier Oedipus? Wer Sphinx? Es ist ein Stelldichein, wie es scheint, von Fragen und Fragezeichen. - Und sollte man's glauben, dass es uns schliesslich bedünken will, als sei das Problem noch nie bisher gestellt, - als sei es von uns zum ersten Male gesehn, in's Auge gefasst, gewagt? Denn es ist ein Wagnis dabei, und vielleicht giebt es kein gr?sseres.
2.
"Wie k?nnte Etwas aus seinem Gegensatz entstehn? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrthume? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur T?uschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutze? Oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Begehrlichkeit? Solcherlei Entstehung ist unm?glich; wer davon tr?umt, ein Narr, ja Schlimmeres; die Dinge h?chsten Werthes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben, - aus dieser verg?nglichen verführerischen t?uschenden geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar! Vielmehr im Schoosse des Sein's, im Unverg?nglichen, im verborgenen Gotte, im `Ding an sich` - da muss ihr Grund liegen, und sonst nirgendswo!" - Diese Art zu urtheilen macht das typische Vorurtheil aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wieder erkennen lassen; diese Art von Werthsch?tzungen steht im Hintergrunde aller ihrer logischen Prozeduren; aus diesem ihrem "Glauben" heraus bemühn sie sich um ihr "Wissen", um Etwas, das feierlich am Ende als "die Wahrheit" getauft wird. Der Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegens?tze der Werthe. Es ist auch den Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am n?thigsten war: selbst wenn sie sich gelobt hatten "de omnibus dubitandum". Man darf n?mlich zweifeln, erstens, ob es Gegens?tze überhaupt giebt, und zweitens, ob jene volksthümlichen Werthsch?tzungen und Werth-Gegens?tze, auf welche die Metaphysiker ihr Siegel gedrückt haben, nicht vielleicht nur Vordergrunds-Sch?tzungen sind, nur vorl?ufige Perspektiven, vielleicht noch dazu aus einem Winkel heraus, vielleicht von Unten hinauf, Frosch-Perspektiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, der den Malern gel?ufig ist? Bei allem Werthe, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag: es w?re m?glich, dass dem Scheine, dem Willen zur T?uschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben h?herer und grunds?tzlicherer Werth zugeschrieben werden müsste. Es w?re sogar noch m?glich, dass was den Werth jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten Dingen auf verf?ngliche Weise verwandt, verknüpft, verh?kelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht! - Aber wer ist Willens, sich um solche gef?hrliche Vielleichts zu kümmern! Man muss dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten, solcher, die irgend welchen anderen umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen, - Philosophen des gef?hrlichen Vielleicht in jedem Verstande. - Und allen Ernstes gesprochen: ich sehe solche neue Philosophen heraufkommen.
3.
Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehn habe, sage ich mir: man muss noch den gr?ssten Theil des bewussten Denkens unter die Instinkt-Th?tigkeiten rechnen, und sogar im Falle des philosophischen Denkens; man muss
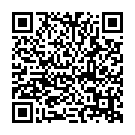
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



