die Tatsache, daß neben den
genetischen zunehmend auch andere Mittel am Entwicklungsprozeß
beteiligt waren. Was wir heute als unsere geistigen Fähigkeiten
bezeichnen, ist das Ergebnis eines relativ kurzen, komprimierten
Entwicklungsprozesses. Erste Zeichenspuren Zeichen können
aufgezeichnet werden--in und auf unterschiedlichsten Materialien; das
gleiche gilt für die Sprache, die indes nicht in Form eines
Schriftsystems entstand. Der Ishango Knochen aus Afrika ist einige
tausend Jahre älter als jedes Schriftsystem; mit den Quipu-Schnüren
nahmen die Inkas eine chronologische und statistische Erfassung von
Menschen, Tieren und Waren vor; auch in China, Japan und Indien
kannte man Aufzeichnungsmethoden, die der Schriftlichkeit
vorausgingen.
Die polygenetische Herausbildung von Schriftsprache ist in mancherlei
Hinsicht bedeutsam. Zum einen bot sie eine neue, vom individuellen
Sprecher losgelöste Vermittlungsinstanz. Zum zweiten schuf sie einen
im Vergleich zum mündlichen Ausdruck höheren Allgemeinheitsgrad,
der unabhängig von Zeit, Raum und anderen Aufzeichnungsmethoden
war. Und drittens trug alles, was in Zeichen und darüber hinaus in
ausformulierte Sprache hineinprojiziert wurde, zur Formation von
Bedeutung bei--als Ergebnis des Verstehens von Sprache, das sich aus
ihrer Verwendung ergab. Erst dadurch erhielt die Sprache ihre
semantische und syntaktische Dimension.
Wenn wir Fragen der Schriftkultur und der Sprachentstehung
verknüpfen, dann ist deren gemeinsame Grundlage die Schriftsprache.
Gleichwohl geben uns Vorgänge, die der Schriftsprachlichkeit
vorausgingen, Aufschlüsse darüber, welche Faktoren die Schriftsprache
erforderlich machten und warum manche Kulturen niemals eine
Schriftsprache entwickelt haben. Dies wiederum könnte trotz des weit
zurückliegenden Zeitrahmens (von tausenden von Jahren) erklären,
warum Schreiben und Lesen nicht notwendigerweise unser heutiges
und zukünftiges Leben und Arbeiten beherrschen müssen. Zumindest
könnten wir das Verhältnis zwischen Mensch, Sprache und Dasein
besser verstehen. Wir betrachten das Wort als etwas selbstverständlich
Gegebenes und fragen uns, ob es je einen Menschen ohne Wort
gegeben hat. Als das Wort aber erst einmal durch die Möglichkeit
seiner Aufzeichnung etabliert war, beeinflußte es nicht nur die
zukünftige Entwicklung, sondern auch das Verständnis der
Vergangenheit.
Das Wort bemächtigt sich der Vergangenheit und verleiht den
Erklärungen, die die Existenz des Wortes voraussetzen, ihre Legitimität.
Es beruht auf einem Notationssystem, das zugleich eine Art
eingebautes Gedächtnis und ein Mechanismus für Assoziationen,
Permutationen und Substitutionen ist. Wenn wir aber die Ursprünge des
Lesens und Schreibens so weit zurückverlegen, dann erweist sich der
Gegensatz von Schriftlichkeit und Schriftlosigkeit als Strukturmerkmal
nur einer der zahlreichen menschlichen Entwicklungsperioden. In einer
so weiten zeitlichen Perspektive widerspricht unsere Auffassung von
Notation (zu der wir auch Bilder, den Ishango Knochen, die
Quipu-Schnüre, die Vinca-Figuren usw. zählen) dem logokratischen
Sprachmodell. Ein- und mehrsilbige Sprachelemente, hörbare
Lautfolgen (und entsprechende Atemtechniken, die Pausen vorsehen
und Synchronisierungsmechanismen ermöglichen) sowie natürliche
Mnemotechniken (Kiesel, Astknoten, Steingestalten usw.) sind dem
Wort vorausgehende Komponenten einer vorsprachlichen Notation. Sie
entsprechen allesamt einem durch direkte Interaktion gekennzeichneten
Entwicklungsstadium. Sie beziehen sich auf eine kleine Skala
menschlichen Handelns, in welcher Zeit und Raum noch in Form
natürlicher Strukturen (Tag-Nacht, nah-fern, usw.) eingeteilt werden
können.
Der entscheidende Entwicklungsschritt in der Selbstkonstituierung des
Menschen wurde mit dem Übergang von aus der Natur ausgewählten
Zeichen zum Bezeichnen vollzogen, ein Prozeß, der zu etablierten
Klangmustern und schließlich zum Wort führte. Diese Veränderung
führte lineare Beziehungen in einen sich als zufällig oder chaotisch
darbietenden Bereich ein. Auch entwickelten sich neue Formen der
Interaktion: Namensgebung (durch Assoziation, etwa wenn Clans die
Namen von Tieren trugen), Ordnen und Zählen (zunächst die paarweise
Zuordnung der gezählten Gegenstände zu anderen Gegenständen) oder
die Aufzeichnung von Regelmäßigkeiten (des Wetters, der
Himmelsbeschaffenheit, biologischer Zyklen), soweit sie sich auf das
Ergebnis praktischer Tätigkeiten auswirkten.
Skala und Schwelle
Auf den vorangegangenen Seiten ist der Begriff der Skala als wichtiger
Parameter der Menschheitsentwicklung wiederholt verwendet worden.
Da er für die Erklärung großer Veränderungen im menschlichen
Handeln von zentraler Bedeutung ist, soll er etwas näher erläutert
werden. So geht die Entwicklung von präverbalen Zeichen zu
Notationsformen und in unserer Zeit von Alphabetismus zu einem
Stadium jenseits der Schriftlichkeit (PostAlphabetismus) einher mit
einer Fortentwicklung der (Erfahrungs- und Handlungs-) Skala des
Menschen. Reine Zahlen--etwa darüber, wie viele Menschen in einem
bestimmten Gebiet leben oder in einem bestimmten praktischen
Erfahrungszusammenhang interagieren, die Lebensdauer von
Menschen unter bestimmten Bedingungen, Sterblichkeitsrate,
Familiengröße--sagen dabei wenig oder gar nichts aus. Nur wenn
Zahlen zu Lebensumständen in Beziehung gesetzt werden können, sind
sie aufschlußreich. Der Begriff der Skala drückt derartige Beziehungen
aus.
So brachte die Haltung von Haustieren, die eine entscheidende
Erweiterung der Handlungsskala bedeutete, mit sich, daß bestimmte
Tierkrankheiten auf die Menschen übertragen wurden und deren Leben
und Arbeit nachhaltig beeinträchtigten. Der Schnupfen wurde wohl
vom Pferd auf den Menschen übertragen, die Grippe vom Schwein, die
Windpocken vom Rind. Auch wissen wir, daß sich über einen längeren
Zeitraum gesehen Infektionskrankheiten (Gelbfieber, Malaria oder
Masern) negativ auf große, stationäre menschliche Populationen
auswirken. Wichtige Erkenntnisse liefern uns bisweilen auch jene
isolierten Volksstämme, deren heutige Lebensformen denen aus weit
zurückliegenden Entwicklungsstadien noch weitgehend ähnlich sind,
also zum Beispiel die Indianerstämme des Amazonas. Sie weisen
Anpassungsstrategien auf, die wir ohne Anschauung kaum verstehen
könnten. Die aus
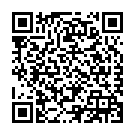
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



