mit dem Ausdrucke verbinden lie?, so weit trieb er ihn. Das H??liche w?re er gern übergangen, h?tte er gern gelindert; aber da ihm seine Komposition beides nicht erlaubte, was blieb ihm anders übrig, als es zu verhüllen?--Was er nicht malen durfte, lie? er erraten. Kurz, diese Verhüllung ist ein Opfer, das der Künstler der Sch?nheit brachte. Sie ist ein Beispiel, nicht wie man den Ausdruck über die Schranken der Kunst treiben, sondern wie man ihn dem ersten Gesetze der Kunst, dem Gesetze der Sch?nheit, unterwerfen soll.
{9. Plinius lib. XXXV. sect. 36. Cum moestos pinxisset omnes, praecipue patruum, et tristitiae omnem imaginem consumpsisset, patris ipsius vultum velavit, quem digne non poterat ostendere.}
{10. Summi moeroris acerbitatem arte exprimi non posse confessus est. Valerius Maximus lib. VIII. cap. 11.}
Und dieses nun auf den Laokoon angewendet, so ist die Ursache klar, die ich suche. Der Meister arbeitete auf die h?chste Sch?nheit, unter den angenommenen Umst?nden des k?rperlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden Heftigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er mu?te ihn also herabsetzen; er mu?te Schreien in Seufzen mildern; nicht weil das Schreien eine unedle Seele verr?t, sondern weil es das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet. Denn man rei?e dem Laokoon in Gedanken nur den Mund auf, und urteile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine Bildung, die Mitleid einfl??te, weil sie Sch?nheit und Schmerz zugleich zeigte; nun ist es eine h??liche, eine abscheuliche Bildung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Anblick des Schmerzes Unlust erregt, ohne da? die Sch?nheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das sü?e Gefühl des Mitleids verwandeln kann.
Die blo?e weite ?ffnung des Mundes,--beiseitegesetzt, wie gewaltsam und ekel auch die übrigen Teile des Gesichts dadurch verzerret und verschoben werden,--ist in der Malerei ein Fleck und in der Bildhauerei eine Vertiefung, welche die widrigste Wirkung von der Welt tut. Montfaucon bewies wenig Geschmack, als er einen alten b?rtigen Kopf, mit aufgerissenem Munde, für einen Orakel erteilenden Jupiter ausgab 11). Mu? ein Gott schreien, wenn er die Zukunft er?ffnet? Würde ein gef?lliger Umri? des Mundes seine Rede verd?chtig machen? Auch glaube ich es dem Valerius nicht, da? Ajax in dem nur gedachten Gem?lde des Timanthes sollte geschrien haben 12). Weit schlechtere Meister aus den Zeiten der schon verfallenen Kunst lassen auch nicht einmal die wildesten Barbaren, wenn sie unter dem Schwerte des Siegers Schrecken und Todesangst ergreift, den Mund bis zum Schreien ?ffnen 13).
{11. Antiquit. expl. T. I. p. 50.}
{12. Er gibt n?mlich die von dem Timanthes wirklich ausgedrückten Grade der Traurigkeit so an: Calchantem tristem, moestum Ulyssem, clamantem Ajacem, lamentantem Menelaum.--Der Schreier Ajax mü?te eine h??liche Figur gewesen sein; und da weder Cicero noch Quintilian in ihren Beschreibungen dieses Gem?ldes seiner gedenken, so werde ich ihn um so viel eher für einen Zusatz halten dürfen, mit dem es Valerius aus seinem Kopfe bereichern wollen.}
{13. Bellorii Admiranda. Tab. 11. 12.}
Es ist gewi?, da? diese Herabsetzung des ?u?ersten k?rperlichen Schmerzes auf einen niedrigern Grad von Gefühl, an mehrern alten Kunstwerken sichtbar gewesen. Der leidende Herkules in dem vergifteten Gewande, von der Hand eines alten unbekannten Meisters, war nicht der Sophokleische, der so gr??lich schrie, da? die lokrischen Felsen, und die eub?ischen Vorgebirge davon ert?nten. Er war mehr finster, als wild 14). Der Philoktet des Pythagoras Leontinus schien dem Betrachter seinen Schmerz mitzuteilen, welche Wirkung der geringste gr??liche Zug verhindert h?tte. Man dürfte fragen, woher ich wisse, da? dieser Meister eine Bilds?ule des Philoktet gemacht habe. Aus einer Stelle des Plinius, die meine Verbesserung nicht erwartet haben sollte, so offenbar verf?lscht oder verstümmelt ist sie 15).
{14. Plinius libr. XXXIV, sect. 19.}
{15. Eundem, n?mlich den Myro, lieset man bei dem Plinius (libr. XXXIV. sect. 19) vicit et Pythagoras Leontinus, qui fecit stadiodromon Astylon, qui Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenentem tabulam, eodem loco, et mala ferentem nudum. Syracusis autem claudicantem: cujus hulceris dolorem sentire etiam spectantes videntur. Man erw?ge die letzten Worte etwas genauer. Wird nicht darin offenbar von einer Person gesprochen, die wegen eines schmerzhaften Geschwüres überall bekannt ist? Cujus hulceris usw. Und dieses cujus sollte auf das blo?e claudicantem, und das claudicantem vielleicht auf das noch entferntere puerum gehen? Niemand hatte mehr recht, wegen eines solchen Geschwüres bekannter zu sein, als Philoktet. Ich lese also anstatt claudicantem, Philoctetem, oder halte wenigstens dafür, da? das letztere durch das erstere gleichlautende Wort verdrungen worden, und man beides zusammen Philoctetem claudicantem lesen müsse. Sophokles l??t ihn stibon kai anagkan erpein, und es mu?te ein Hinken verursachen, da? er auf den kranken Fu? weniger herzhaft auftreten konnte.}
III.
Aber, wie schon gedacht, die Kunst hat in den neuern Zeiten ungleich weitere Grenzen erhalten. Ihre Nachahmung, sagt man, erstrecke sich auf die ganze sichtbare Natur, von welcher das Sch?ne nur ein kleiner Teil ist. Wahrheit und Ausdruck sei ihr erstes Gesetz; und wie die Natur selbst die Sch?nheit h?hern Absichten jederzeit
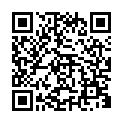
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



