doch für ein derbes arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit abzuthun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag.
15.
Um Physiologie mit gutem Gewissen zu treiben, muss man darauf halten, dass die Sinnesorgane nicht Erscheinungen sind im Sinne der idealistischen Philosophie: als solche k?nnten sie ja keine Ursachen sein! Sensualismus mindestens somit als regulative Hypothese, um nicht zu sagen als heuristisches Princip. - Wie? und Andere sagen gar, die Aussenwelt w?re das Werk unsrer Organe? Aber dann w?re ja unser Leib, als ein Stück dieser Aussenwelt, das Werk unsrer Organe! Aber dann w?ren ja unsre Organe selbst - das Werk unsrer Organe! Dies ist, wie mir scheint, eine gründliche reductio ad absurdum: gesetzt, dass der Begriff causa sui etwas gründlich Absurdes ist. Folglich ist die Aussenwelt nicht das Werk unsrer Organe -?
16.
Es giebt immer noch harmlose Selbst-Beobachter, welche glauben, dass es "unmittelbare Gewissheiten" gebe, zum Beispiel "ich denke", oder, wie es der Aberglaube Schopenhauer's war, "ich will": gleichsam als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bek?me, als "Ding an sich", und weder von Seiten des Subjekts, noch von Seiten des Objekts eine F?lschung stattf?nde. Dass aber "unmittelbare Gewissheit", ebenso wie "absolute Erkenntniss" und "Ding an sich", eine contradictio in adjecto in sich schliesst, werde ich hundertmal wiederholen: man sollte sich doch endlich von der Verführung der Worte losmachen! Mag das Volk glauben, dass Erkennen ein zu Ende-Kennen sei, der Philosoph muss sich sagen: "wenn ich den Vorgang zerlege, der in dem Satz `ich denke` ausgedrückt ist, so bekomme ich eine Reihe von verwegenen Behauptungen, deren Begründung schwer, vielleicht unm?glich ist, - zum Beispiel, dass ich es bin, der denkt, dass überhaupt ein Etwas es sein muss, das denkt, dass Denken eine Th?tigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als Ursache gedacht wird, dass es ein `Ich` giebt, endlich, dass es bereits fest steht, was mit Denken zu bezeichnen ist, - dass ich weiss, was Denken ist. Denn wenn ich nicht darüber mich schon bei mir entschieden h?tte, wonach sollte ich abmessen, dass, was eben geschieht, nicht vielleicht `Wollen` oder `Fühlen` sei? Genug, jenes `ich denke` setzt voraus, dass ich meinen augenblicklichen Zustand mit anderen Zust?nden, die ich an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist: wegen dieser Rückbeziehung auf anderweitiges `Wissen` hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare `Gewissheit`." - An Stelle jener "unmittelbaren Gewissheit", an welche das Volk im gegebenen Falle glauben mag, bekommt dergestalt der Philosoph eine Reihe von Fragen der Metaphysik in die Hand, recht eigentliche Gewissensfragen des Intellekts, welche heissen: "Woher nehme ich den Begriff Denken? Warum glaube ich an Ursache und Wirkung? Was giebt mir das Recht, von einem Ich, und gar von einem Ich als Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedanken-Ursache zu reden?" Wer sich mit der Berufung auf eine Art Intuition der Erkenntniss getraut, jene metaphysischen Fragen sofort zu beantworten, wie es Der thut, welcher sagt: "ich, denke, und weiss, dass dies wenigstens wahr, wirklich, gewiss ist" - der wird bei einem Philosophen heute ein L?cheln und zwei Fragezeichen bereit finden. "Mein Herr, wird der Philosoph vielleicht ihm zu verstehen geben, es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich nicht irren: aber warum auch durchaus Wahrheit?" -
17.
Was den Aberglauben der Logiker betrifft: so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Thatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergl?ubischen ungern zugestanden wird, - n?mlich, dass ein Gedanke kommt, wenn "er" will, und nicht wenn "ich" will; so dass es eine F?lschung des Thatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt "ich" ist die Bedingung des Pr?dikats "denke". Es denkt: aber dass dies "es" gerade jenes alte berühmte "Ich" sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor Allem keine "unmittelbare Gewissheit". Zuletzt ist schon mit diesem "es denkt" zu viel gethan: schon dies "es" enth?lt eine Auslegung des Vorgangs und geh?rt nicht zum Vorgange selbst. Man schliesst hier nach der grammatischen Gewohnheit "Denken ist eine Th?tigkeit, zu jeder Th?tigkeit geh?rt Einer, der th?tig ist, folglich -". Ungef?hr nach dem gleichen Schema suchte die ?ltere Atomistik zu der "Kraft", die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt, aus der heraus sie wirkt, das Atom; strengere K?pfe lernten endlich ohne diesen "Erdenrest" auskommen, und vielleicht gew?hnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der Logiker ohne jenes kleine "es" (zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat) auszukommen.
18.
An einer Theorie ist wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, dass sie widerlegbar ist: gerade damit zieht sie feinere K?pfe an. Es scheint, dass die hundertfach widerlegte Theorie vom "freien Willen" ihre Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt -: immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen.
19.
Die Philosophen pflegen vom Willen zu reden, wie als ob er die bekannteste Sache von der Welt sei; ja Schopenhauer gab zu verstehen,
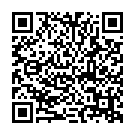
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



